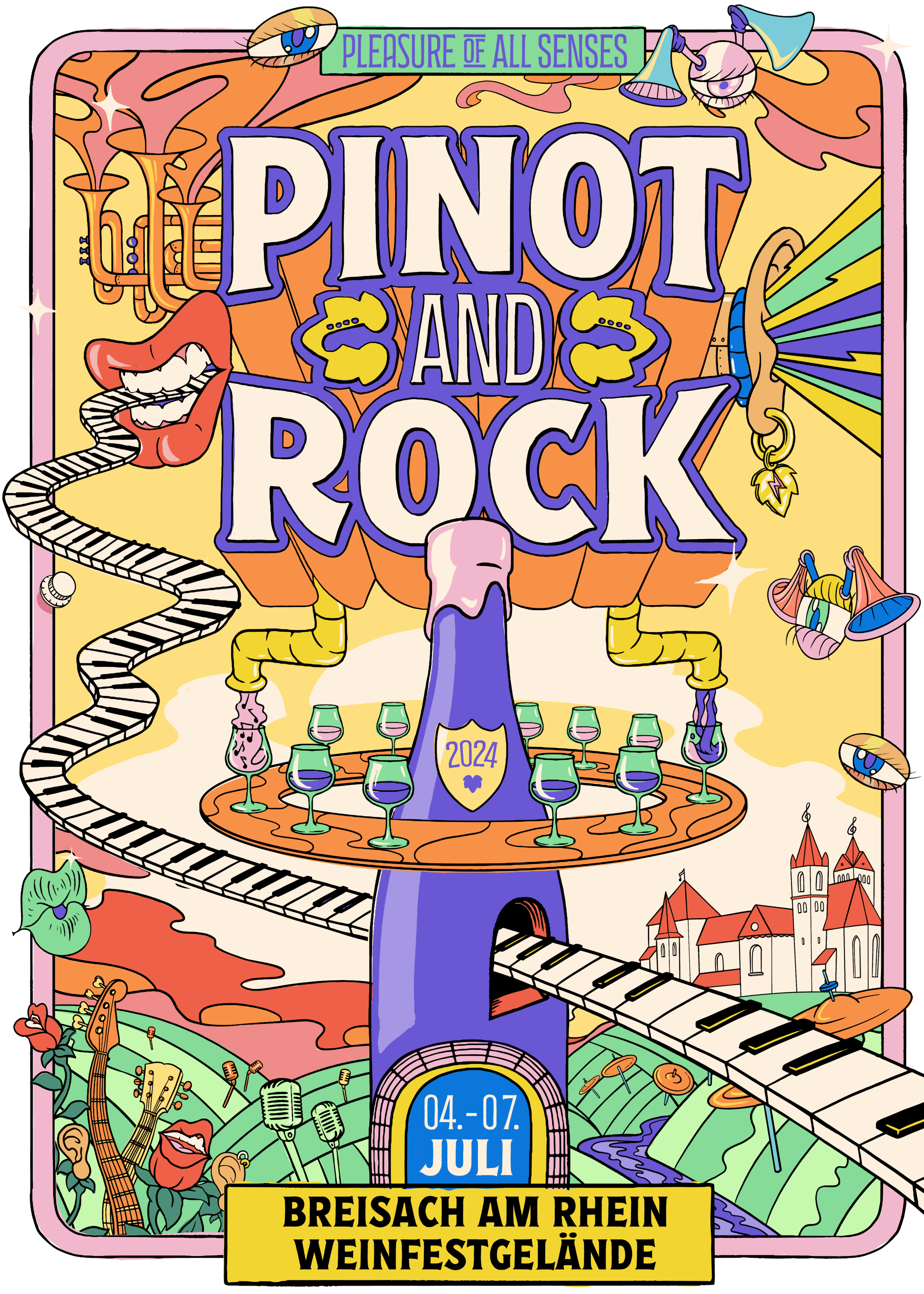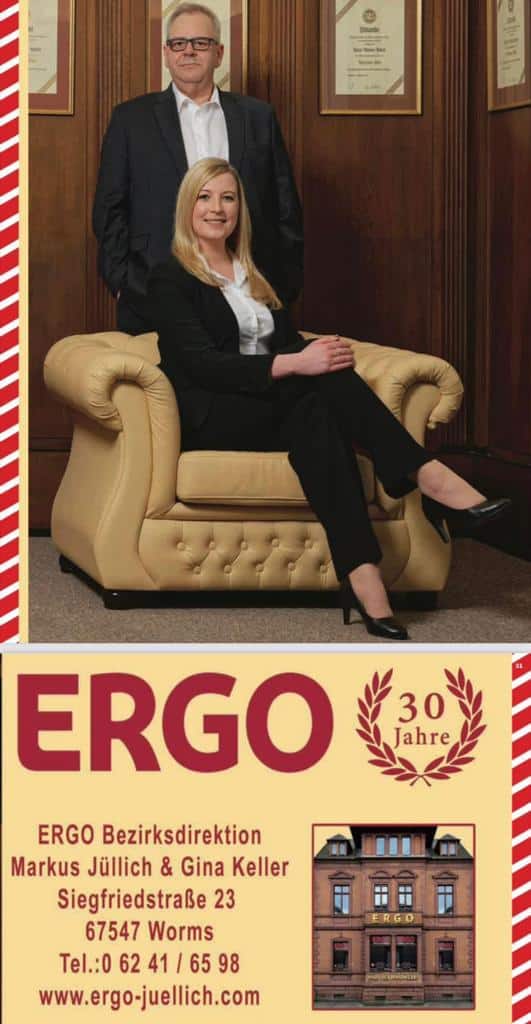Der Name Brönner ist im Jazz längst zu einem geflügelten Wort geworden. Denn zwischen Echo Jazz-Auszeichnungen und einem Auftritt im Weißen Haus, seiner Trompeten-Professur und der Jury von X-Factor eröffnet sich der Horizont eines Künstlers, der sich sein eigenes künstlerisches Lebensmosaik mit Sorgfalt und Wonne gleichermaßen zusammengelegt hat. Bevor der 48-jährige Ausnahmesolist am 21. November mit seiner Produktion „Better Than Christmas“ im Mannheimer Rosengarten gastiert, haben wir mit dem passionierten Fotograf und Vollblutmusiker gesprochen. Ein Gespräch über Hochmut, Authentizität und die Kraft des Jazz.
Herr Brönner, wenn Sie als Jazzmusiker darüber nachdenken, welche Popularität Sie in den vergangenen Jahren eigentlich erreicht haben: Ist Ihnen das manchmal ein wenig unheimlich?
Till Brönner: Popularität ist immer ein zweischneidiges Schwert – und relativ. Sie kann Dich als Künstler bestechen. Ich bin in einem musikalischen Genre zu Hause, in dem der geleistete Bühnenmoment über die Frage des Erfolgs erhaben ist. Mein Weg ist die Dinge so persönlich wie möglich zu präsentieren, wahrhaftig zu sein. Dann ist geringerer oder ausbleibender Erfolg nichts, das man zu persönlich nimmt. Man ist sich treu geblieben.
Sie sind diesen Weg von den kleinen Clubs aus konsequent gegangen. Hatten Sie eingepreist, dass Sie eines Tages – wie bald ja auch im Rosengarten – vor mehreren tausend Zuhörern spielen würden?
Brönner: Ohne Ziele macht es auch keinen Spass. Ich wollte einen Unterschied machen. Natürlich hätte ich meinen Weg trotz allem nicht vorhersagen können und es gab auch Menschen die von dieser Laufbahn abgeraten haben. Aufgehalten hat es mich nicht. Vielleicht war es sogar heilsam, dass meine Karriere in kleinen Clubs begonnen hat. Denn es gibt Karrieren, die beginnen so schlagartig, dass sofort in den ganz großen Hallen gespielt wird und plötzlich dann gar nicht mehr. Da halte ich für wesentlich gesünder, was ich erleben durfte. Und wenn es irgendwann mal wieder in die kleinen Clubs zurückgeht, bin ich immer noch zuhause. Ein recht schöner Ausblick, finde ich.
Was uns zu dem sehr spannenden Punkt bringt, dass Sie in Ihrer Karriere ja nicht nur mit Größen wie Dave Brubeck und Hildegard Knef zusammengearbeitet haben, sondern mittlerweile auf einer Ebene betrachtet werden. Was macht das denn mit Ihnen als Künstler?
Brönner: Ich denke es hat vor allem mit dem Thema Endlichkeit zu tun. Im Moment erfreue ich mich noch bester Gesundheit, aber es ist durchaus so, dass sich in der Zeit, die ich dabei bin, viele Dinge wirklich grundlegend geändert haben. Viele Zeitgenossen sind nicht mehr da, aber ich hatte noch die Chance mit ihnen zu arbeiten. Ich bin so etwas wie ein Träger von sogenannter „first hand information“. Ich habe den Bassisten Ray Brown damals gefragt, wie es war mit Charlie Parker zu spielen und seine Antwort stand in keinem Lehrbuch. Ich sprach mit einem Original, einem weitgereisten Mann, der die Musik nicht nur spielte, sondern lebte. Das war wesentlich. Heute ist es quasi unmöglich diesen Hintergrund noch zu haben. Und doch ist Jazz im Idealfalle eine Musik, die politische oder gesellschaftliche Gegenwart zu spiegeln vermag. Es erscheint heute jedoch unwahrscheinlicher denn im Alltag auf sie zu treffen. Man muss sie ja fast akribisch suchen – in der Radiolandschaft zum Beispiel.
Den Spagat zwischen der Musikhochschulprofessur und der Eigenschaft als Juror bei X Factor haben sie trotzdem gewagt. Wie verbindet man solche Kontraste denn mit dem gewünschten Niveau, ohne in eine Richtung abzustürzen?
Brönner: Man muss spüren wann Schluss ist mit Spagat. Der Fächer, den man da aufspannt, ist bei einem breiter, beim anderen schmaler und ich darf sagen, dass ich anfangs wirklich Bedenken hatte, mich in die äußersten Randbereiche dessen zu bewegen, was mich ausmacht. Aber dann ist es doch die Herausforderung für mich, zu zeigen, dass es auch im Mainstream-Fernsehen um Substanz und Ehrlichkeit gehen kann. Und siehe da: Ich wurde verstanden. Auch, wenn das mit Trompete spielen nicht sehr viel zu tun hatte, musste ich niemandem künstlich Honig ums Maul schmieren und habe wirklich gesagt, was ich dachte. Ich bin halt irgendwann ausgestiegen, weil ich die Trompete vermisst habe, aber nicht, weil ich das Gefühl hatte, dort nicht wahrhaftig gewesen zu sein.
Wie wahrhaftig fühlt es sich denn an, jenseits des Kommerzes zu seiner eigenen künstlerischen Handschrift zu stehen und genau dafür ins Weiße Haus eingeladen zu werden?
Brönner: Ich hoffe immer, dass ein solcher Moment nicht zu viel an der eigenen Wahrnehmung ändert. Wenn man mit einer halbwegs stabilen Einstellung ins Weiße Haus kommt, sollte man es im besten Fall auch wieder damit verlassen können. Aber man spürte deutlich, dass der Vorgang historisch nicht ganz unbedeutsam war: Der erste afroamerikanische Präsident der USA holt sich die offiziellste Kunstform Nordamerikas –Jazz – so öffentlich in’s Weiße Haus. Das gab’s noch nie. Und ich war dabei.
Umso interessanter, dass Sie die Weihnachtstournee – kommerziell vollkommen anachronistisch – über ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung Ihres Albums spielen. War das ein bewusstes Warten, oder kommt man dann einfach wieder auf die alten Gedanken zurück?
Brönner: Es war auf gar keinen Fall ein Sinneswandel, dafür bin ich lange genug dabei. Bei mir ist immer mit etwas zu rechnen, das gerade keiner erwartet. Das kann auch ein Album mit Dieter Ilg oder Günter „Baby“ Sommer sein. Erwartet hat diese Platten keiner, aber sie haben eben diebischen Spaß gemacht. Und die Tour heißt ja auch nicht „Christmas Forever“, sondern „Better Than Christmas“. Letztlich deutet das darauf hin, dass auch das vor zehn Jahren aufgenommene Weihnachts-Album mehr war, als einfach nur ein Weihnachts-Album. Da finden sich Stücke wie „Moon River“ von Henry Mancini oder „Auld Lang Syne“, das eher an etwas wie menschlichen Zusammenhalt appelliert. All das kann am Ende viel politischer sein, als man gemeinhin so denkt. Weihnachten als Eiapopeia-Veranstaltung hinzustellen, hätte mich nicht gereizt. Was mich reizt, ist, auch ein solches Thema künstlerisch hochwertig zu verarbeiten und Kontraste nicht zu scheuen. So wie trotz Weihnachtszeit die Missstände oft direkt vor unserer Haustüre grassieren und es Menschen gibt, die Weihnachten fürchten. Entweder, weil sie nie ein wirkliches Weihnachten erlebt haben, oder, weil diese Tage für sie einfach kein Ende finden wollen. Das gehört zur Realität dazu.
Was Sie ansprechen, ist ja eine Frage des Klimas. Das ist ja nicht nur in Form von ausbleibendem Schnee nicht mehr weihnachtlich, sondern auch mental. Kann die Musik und speziell der Jazz da die Kraft entfalten, diese Gräben zu überwinden?
Brönner: Für gute Musik gibt es keine unpassende Zeit, finde ich. Doch Sie sprechen es an: Man muss bei den Menschen nicht so wahnsinnig lange bohren, um festzustellen, dass der Geist im Land schon mal positiver war. Es regiert vielerorts die Angst vor Veränderung und der Zukunft. Jazz kennt diese Ängste nicht, im Gegenteil. Jazz packt sie bei den Hörnern und wirbelt sie solange durch, bis man ziemlich laut lachen muss. Wenn das keine Kraft ist, was dann?
Wenn ich Sie als passionierten Fotograf fragen darf: Wenn Sie ihr ideales Weihnachten fotografieren müssten: Was dürfte ich denn da auf der Leica wiederfinden?
Brönner: Es dürfte auf jeden Fall kein Bild sein, wie sie so oft im Museum zu sehen sind – mit einer riesigen Texttafel daneben, die das Bild erst erklären muss. Es müsste ein Foto sein, das ohne Worte sofort verstanden wird. Und nachdenklich macht. Das wäre eine wunderbare Aufgabe.
Interview © by Markus Mertens für Cityguide Rhein Neckar | Fotocredit: Patrice Brylla